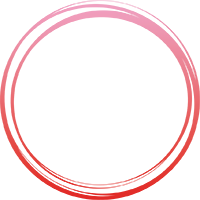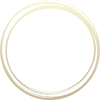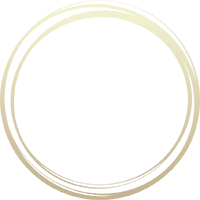Stress verstehen – und was er mit dem Körper macht
Was genau ist Stress – und warum betrifft er uns alle?
Stress ist mehr als nur ein Modewort oder eine subjektive Überforderung. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Physik und beschreibt eine Belastung, die auf ein System einwirkt. In den 1930er-Jahren übertrug der österreichisch-kanadische Arzt und Hormonforscher Hans Selye das Konzept auf den menschlichen Organismus. Für ihn war Stress „die unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung“.
Selye unterschied zwei Arten von Stress:
Eustress – positiver Stress, der aktiviert, motiviert und uns wachsen lässt.
Distress – negativer Stress, der überfordert, schwächt und krank machen kann.
Ob eine Situation als Eustress oder Distress empfunden wird, hängt stark von unserer inneren Haltung, unserer Selbstregulation und unseren Ressourcen ab. Stress ist also kein rein äußeres Phänomen – sondern immer auch eine Frage der Verarbeitung.
Wie der Körper auf Stress reagiert – ein evolutionäres System
Unser Körper reagiert auf potenzielle Bedrohungen seit Jahrtausenden mit einem hochintelligenten Notfallprogramm:
Das autonome Nervensystem, insbesondere der Sympathikus, sorgt dafür, dass wir in Sekundenbruchteilen in Alarmbereitschaft sind:
Die Atmung beschleunigt sich
Der Puls steigt
Blut wird in die Muskulatur gepumpt
Die Verdauung wird heruntergefahren
Der Fokus verengt sich
Diese Reaktion war (und ist) überlebenswichtig – sie versetzt uns in den Modus von Kampf oder Flucht (fight or flight). Ist auch diese Reaktion nicht möglich, folgt oft der Erstarrungszustand (freeze), vermittelt über den dorsalen Vagusnerv.
Doch während unsere Physiologie für kurze, intensive Stressreaktionen gemacht ist, leben viele Menschen heute in einem Zustand dauerhafter Aktivierung – ohne ausreichende Regenerationsphasen.
Chronischer Stress – wenn das System nicht mehr abschaltet
Wird die Stressreaktion nicht unterbrochen oder reguliert, kann sie auf Dauer zu erheblichen körperlichen und psychischen Beschwerden führen. Der Körper bleibt in Alarmbereitschaft, auch wenn keine akute Gefahr mehr besteht.
„It is not stress that kills us, it is our reaction to it.“
– Hans Selye
Typische körperliche Folgen:
Muskelverspannungen, Nacken- und Rückenschmerzen
Magen-Darm-Beschwerden (z. B. Reizdarmsyndrom)
Schlafstörungen, Erschöpfung
hormonelle Dysbalancen, Zyklusunregelmäßigkeiten
Psychische und emotionale Folgen:
Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen
Überforderung, Konzentrationsprobleme
Gefühl von innerer Getriebenheit oder Taubheit
erhöhte Reizempfindlichkeit („nervlich dünnhäutig“)
Besonders heikel: Viele Menschen bemerken den Stress erst, wenn sich Symptome bereits manifestiert haben.
Das Toleranzfenster – zwischen Über- und Untererregung
Ein zentrales Konzept in der modernen Traumatherapie und Körperpsychotherapie ist das sogenannte „Window of Tolerance“ – geprägt vom Professor für Psychiatrie Dr. Dan Siegel. Es beschreibt den Bereich, in dem wir emotional reguliert, präsent und handlungsfähig sind.
Innerhalb des Fensters: Wir können mit Herausforderungen umgehen, Gefühle regulieren und bleiben im Kontakt mit uns und der Welt.
Außerhalb des Fensters: Wir kippen in Übererregung (z. B. Angst, Panik, Druck) oder Untererregung (z. B. Rückzug, Leere, Depression, Dissoziation).
Ein dauerhaft aktiviertes Nervensystem lässt uns immer wieder außerhalb dieses Fensters landen – Stress wird chronisch.
Warum Regulation wichtiger ist als Entspannung
Entspannung ist gut – aber nicht gleichbedeutend mit Regulation. Unser Ziel sollte nicht sein, immer ruhig zu sein, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, zwischen Aktivierung und Ruhe zu pendeln. Diese Fähigkeit nennt man Selbstregulation.
„Regulation is not a technique – it is a relationship to the body.“
– Irene Lyon
Selbstregulation ist eine körperliche Fähigkeit. Sie entsteht durch Erfahrung, Achtsamkeit, Beziehung, Bewegung – nicht durch Nachdenken allein. Viele somatische Verfahren (z. B. Atemarbeit, Embodiment, Vagusaktivierung, achtsame Bewegung) helfen dabei, wieder mehr Spürbewusstsein und Flexibilität im Nervensystem zu entwickeln.
Stress gehört zum Leben – aber nicht zum Dauerzustand
Stress an sich ist nicht das Problem – sondern die fehlende Regulation. Unser Körper verfügt über alle Werkzeuge, um mit Herausforderungen umzugehen. Doch in einer Welt, die kaum Pausen zulässt, lohnt es sich, innezuhalten, hinzuspüren und neue Wege im Umgang mit Stress zu entwickeln.
„In an overstimulated world, slowing down is a superpower.“
– Unbekannt