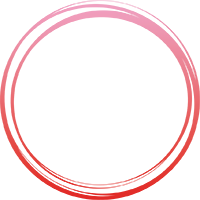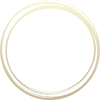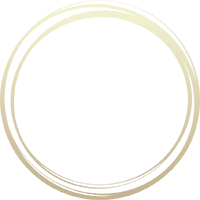Trauma ist nicht, was passiert – sondern, was im Körper bleibt
Trauma wird oft mit außergewöhnlichen, bedrohlichen Ereignissen gleichgesetzt: einem Unfall, einer Gewalterfahrung, einem plötzlichen Verlust. Doch moderne Traumaforschung zeigt ein differenzierteres Verständnis. Der Schlüssel liegt nicht nur im Ereignis selbst – sondern darin, wie unser Körper und unser Nervensystem darauf reagieren und was davon zurückbleibt.
„Trauma is not what happens to us, but what we hold inside in the absence of an empathetic witness.“
– Peter A. Levine
Diese Perspektive spiegelt sich auch in der Arbeit von Bessel van der Kolk wider, der in seinem Buch „Verkörperter Schrecken“ (The Body Keeps the Score) eindrücklich beschreibt, wie tiefgreifend sich traumatische Erfahrungen im Körper einprägen, das Gehirn verändern und das gesamte Erleben beeinflussen – oft lange über das eigentliche Ereignis hinaus.
Trauma und das Nervensystem: Was passiert da eigentlich?
Trauma entsteht, wenn das Nervensystem von einer Situation überwältigt wird, ohne ausreichend innere oder äußere Unterstützung zur Regulation. Es ist nicht nur das Ereignis – sondern das Gefühl, allein, hilflos oder ausgeliefert zu sein.
Unser autonomes Nervensystem reagiert auf Bedrohung mit:
Kampf (fight),
Flucht (flight),
oder wenn beides nicht möglich ist: Erstarrung (freeze).
Diese Reaktionen sind evolutionär sinnvoll und überlebenswichtig. Doch wenn sie nicht abgeschlossen und entladen werden können, bleiben sie als unbewusste Aktivierung oder Blockade im Körper gespeichert – mit langfristigen Folgen für Gesundheit, Stimmung, Selbstbild und Beziehungsfähigkeit.
Polyvagal-Theorie & Co: Wie Sicherheit unser Erleben prägt
Dr. Stephen Porges entwickelte die Polyvagal-Theorie, die zeigt, wie unser autonomes Nervensystem unser Erleben steuert. Zentral ist hier das Gefühl von Sicherheit oder Bedrohung – nicht als rein rationale Einschätzung, sondern als körperlich verankerte Wahrnehmung.
Wir pendeln ständig zwischen drei Zuständen:
Ventral-vagal (Ruhe, soziale Verbundenheit, Sicherheit)
Sympathikus (Aktivierung, Kampf oder Flucht)
Dorsal-vagal (Erschöpfung, Rückzug, Dissoziation)
Bei Trauma kann diese natürliche Flexibilität verloren gehen – das Nervensystem „hängt fest“ in einem Zustand von Alarm oder Abschaltung. Dr. Dan Siegel nennt diesen Zustand ein „verengtes Fenster der Toleranz“ – die Bandbreite, innerhalb derer wir Emotionen regulieren und bewusst handeln können, ist eingeschränkt.
Die körperliche Speicherung von Trauma
Bessel van der Kolk und auch der niederländische Traumaforscher Ellert Nijenhuis betonen: Trauma manifestiert sich nicht nur in Gedanken oder Gefühlen, sondern vor allem in der Körperphysiologie – in chronischer Muskelanspannung, Atemmustern, Herzfrequenz, Hormonspiegeln und sogar in der Art, wie wir uns im Raum bewegen.
Luise Reddemann, eine Pionierin der psychodynamisch-imaginativen Traumatherapie (PITT), hebt die Bedeutung von inneren Bildern, Selbstmitgefühl und schützender Distanzierung hervor – als Wege, um sich dem Erlebten achtsam und sicher zu nähern, ohne erneut überwältigt zu werden.
Warum es nicht um „Zurückgehen“ geht
In der körperorientierten Traumatherapie geht es nicht darum, das Trauma „nachzuerleben“ oder sich zu zwingen, sich zu erinnern. Es geht darum, das Nervensystem wieder zu regulieren, den Körper schrittweise aus chronischer Übererregung oder Erstarrung herauszuführen – und damit die Gegenwart wieder sicher und lebendig erfahrbar zu machen.
Ein zentrales Ziel ist es, das sogenannte „Fenster der Toleranz“ (Dan Siegel) zu erweitern: also jene Bandbreite, in der unser Körper und Geist aktiviert sein können, ohne zu kippen – in Panik, Wut, Erschöpfung oder Taubheit.
„The body always leads us home – if we can simply learn to trust its language.“
– Dan Siegel
Trauma verstehen heißt Körper verstehen
Trauma ist keine Schwäche – es ist eine gesunde Reaktion auf eine ungesunde Erfahrung. Doch wenn das Erlebte nicht verarbeitet werden konnte, bleibt der Körper im „Überlebensmodus“ – auch wenn die Gefahr längst vorbei ist.
Zu lernen, wie wir uns selbst regulieren, sicher verankern und wieder mit unserem Körper in Kontakt kommen, ist ein tiefgreifender Prozess. Dabei helfen:
Körperwahrnehmung und Achtsamkeit
Atemarbeit
sanfte, somatische Übungen (z. B. aus SE, NARM, PITT)
sichere therapeutische Beziehungen
Und vor allem: Geduld. Denn wie Luise Reddemann sagt:
„Was über Jahre verletzt wurde, braucht Zeit, um zu heilen. Aber der Körper vergisst nichts – und auch das Gute kann wieder erinnert werden.“
Literaturliste:
Bessel van der Kolk: Verkörperter Schrecken
Stephen Porges: Die Polyvagal-Theorie
Dan Siegel: Mindsight, The Pocket Guide to Interpersonal Neurobiology
Luise Reddemann: Imagination als heilsame Kraft
Ellert Nijenhuis: The Trinity of Trauma
Peter Levine: Sprache ohne Worte