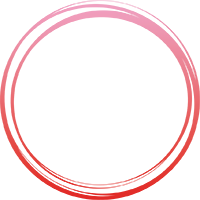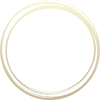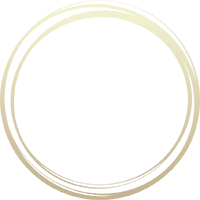Trauma & Körper – warum Reden oft nicht reicht
Viele Menschen verbinden Psychotherapie mit Reden: Gefühle ausdrücken, Erinnerungen sortieren, Gedanken reflektieren. Doch bei Trauma reicht Sprache oft nicht aus. Denn Trauma wird nicht nur erinnert – es wird verkörpert. Es hinterlässt Spuren im Nervensystem, nicht nur in Gedanken oder Emotionen.
Was bleibt, wenn Worte fehlen
Trauma ist keine Schwäche – es ist eine Überlebensreaktion. Wenn eine Situation zu viel, zu schnell oder zu lang war, reagiert unser Nervensystem mit Schutzstrategien wie Erstarrung, Abspaltung oder Daueranspannung. Diese Reaktionen können noch Jahre später aktiv sein, auch wenn das Ereignis längst vorbei ist.
Wie der Traumaforscher Bessel van der Kolk schreibt:
„The body keeps the score.“
(„Der Körper trägt die Last.“)
Trauma verstehen: nicht (nur) kognitiv, sondern verkörpert
Menschen mit traumatischer Vorerfahrung berichten häufig:
„Ich habe meine Geschichte schon so oft erzählt – aber es hat sich nichts verändert.“
Das liegt daran, dass unser Nervensystem auf Sicherheit angewiesen ist, um sich wirklich zu regulieren. Reden kann hilfreich sein – aber wenn der Körper weiter im Alarmzustand ist, reicht das allein oft nicht aus.
Neurowissenschaftlicher Hintergrund
Moderne Traumaforschung betont die Rolle des Körpers und des autonomen Nervensystems. Hier einige relevante Perspektiven:
Stephen Porges entwickelte die Polyvagal-Theorie, die erklärt, wie unser Körper zwischen Stress und Sicherheit hin- und herschaltet. Sie ist Grundlage vieler körperorientierter Therapien.
Pat Ogden (Sensorimotor Psychotherapy) und Ellert Nijenhuis (Enaktive Traumatherapie) zeigen, wie Trauma durch Körperempfindungen und fragmentierte Selbstanteile Ausdruck findet.
Dr. Dan Siegel, Neurowissenschaftler und Psychiater, beschreibt in seiner „interpersonellen Neurobiologie“ die enge Verbindung von Körper, Emotion und Beziehung.
Luise Reddemann kombiniert imaginative Stabilisierung mit ressourcenorientierter innerer Arbeit – körpernah, achtsam, mit großer Sanftheit.
- Peter Levine, Begründer von Somatic Experiencing, zeigt, wie überflutete Energie im Körper stecken bleibt – und durch gezielte Arbeit im sicheren Rahmen entladen und integriert werden kann.
Diese Theorien bilden die Basis für viele moderne psychotherapeutische Ansätze, die den Körper bewusst einbeziehen.
Mein Zugang: achtsam, körperorientiert, ressourcenfokussiert
In meiner Arbeit ist der Körper kein „Zusatz“, sondern ein zentraler Partner im therapeutischen Prozess. Ich arbeite mit:
achtsamer Körperwahrnehmung
Focusing-Elementen (nach Gendlin): das leise Spüren des „felt sense“ – einer körperlich fühlbaren Bedeutung
Regulation des Nervensystems durch Atem, Haltung, sanfte Bewegungen
Stärkung von Selbstwahrnehmung und innerer Sicherheit
Ziel ist nicht die schnelle Auflösung von Symptomen, sondern die langsame Rückkehr in Verbindung – mit sich selbst, dem Körper, dem Hier & Jetzt.
Warum Körperarbeit so wertvoll ist
Körperorientierte Traumatherapie bedeutet:
Sicherheit nicht nur verstehen, sondern spüren
Achtsamkeit für innere Grenzen und Reaktionen entwickeln
Selbstregulation als verkörperte Fähigkeit erleben
Neue, gesunde Muster langsam aufbauen – ohne Druck, mit viel Geduld
Denn: Heilung geschieht nicht im Kopf allein. Sie braucht den ganzen Menschen – fühlend, atmend, lebendig.